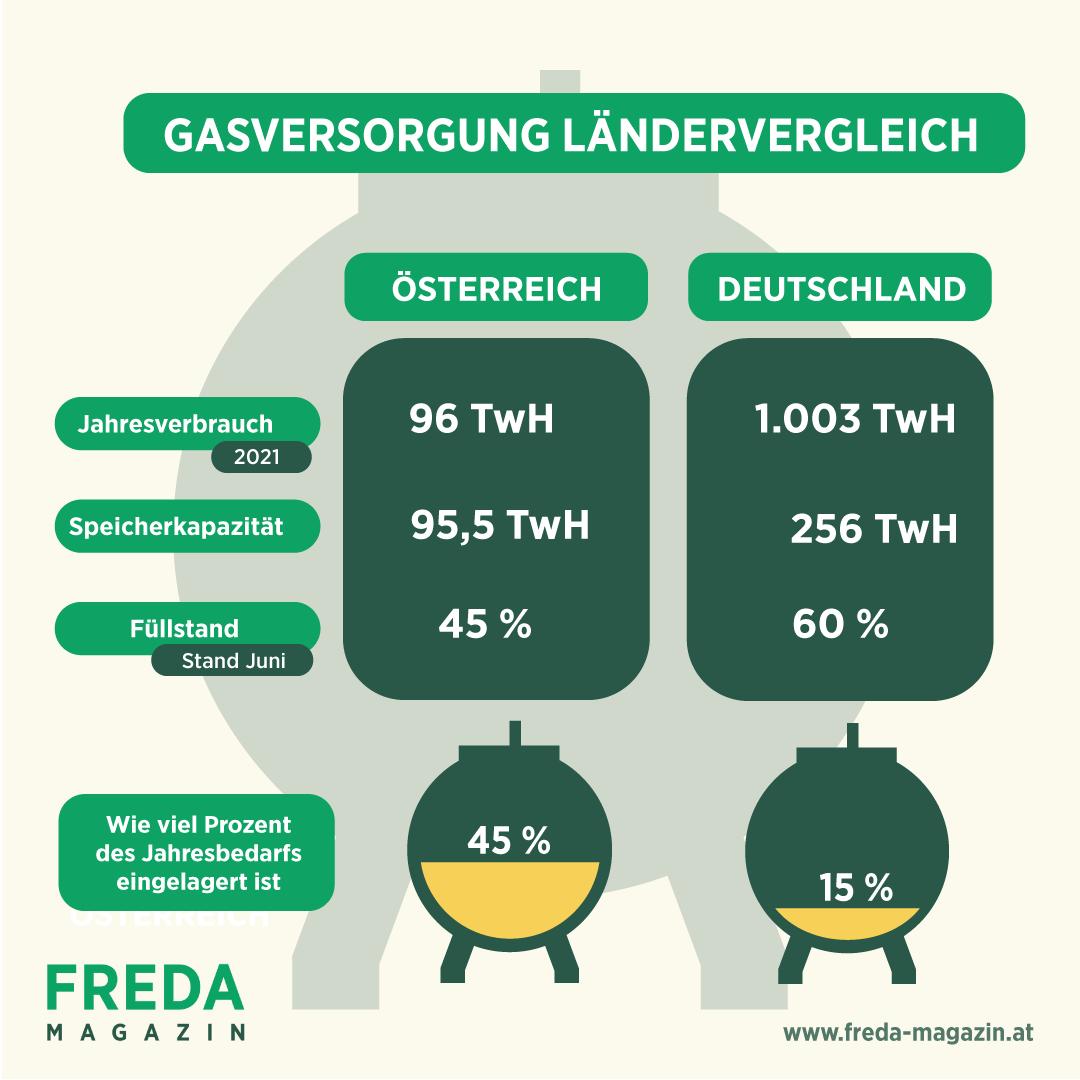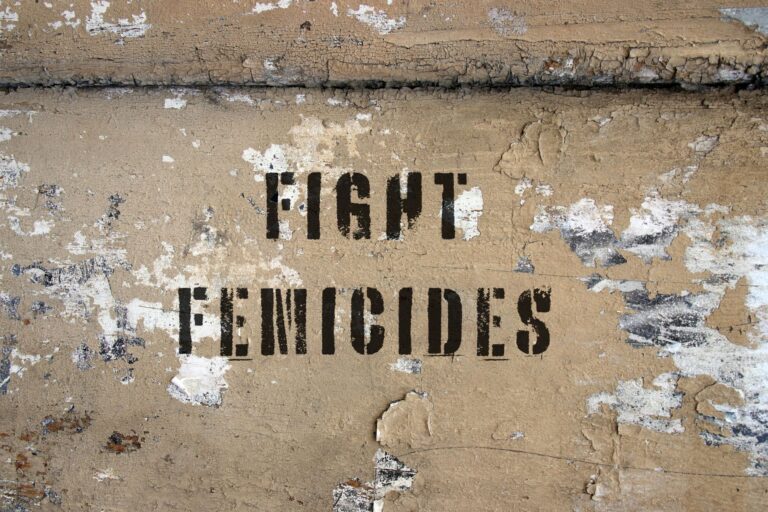Die Coronapandemie setzt den Pflegekräften extrem zu. Immer mehr Überstunden sammeln sich an, die psychische Belastung steigt. Die Folge: Das Interesse am Pflegeberuf sinkt. Doch qualifiziertes Personal wird dringend gebraucht. Mit der Pflegereform will die Regierung einen Pflegenotstand verhindern. Die wichtigsten Fragen dazu beantwortet.
Sie sind Bezugspersonen und Stützen im Alltag. Sie helfen beim Waschen, Anziehen und Kochen. In einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft werden Pflegekräfte immer wichtiger. Doch das Interesse an diesem Beruf sinkt. Er ist körperlich und psychisch belastend, erfordert viel Kraft und ist schlecht bezahlt. Die Coronapandemie hat die Probleme verschärft. Vielerorts können nicht alle Betten belegt werden, weil schlichtweg das nötige Personal fehlt. Die Regierung hat nun eine Pflegereform präsentiert, um mehr Menschen in den Pflegeberuf zu holen.
Warum ist die Pflegereform notwendig?
Nicht erst seit Ausbruch der Pandemie weiß man, dass es im Pflegesystem hakt. Vor allem beim Personal. Die Bevölkerung wird immer älter, die Nachfrage nach Pflege steigt. Gleichzeitig beginnen immer weniger eine Ausbildung in diesem Bereich. Nicht nur, dass das Berufsfeld an sich fordernd ist. Viele wissen nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt während der Ausbildung sichern sollen. Laut einer Bedarfsprognose der Gesundheit Österreich braucht das System aber bis 2030 75.700 zusätzliche Pflegekräfte. Mit mehr Geld will die Regierung Arbeitsbedingungen verbessern und den Berufseinstieg erleichtern.
Wie viel will die Bundesregierung investieren, damit das gelingt?
Das Investitionsvolumen beträgt eine Milliarde Euro bis Ende der Gesetzgebungsperiode. „Klatschen allein ist zu wenig! Die Bundesregierung hat deshalb das größte Reformpaket der letzten Jahrzehnte für die Pflege zusammengestellt“, sagt Sozialminister Johannes Rauch. Von dieser Milliarde profitieren primär Frauen, denn in Österreich sind 80 Prozent der Pflegekräfte weiblich.
Wohin geht die Pflegemilliarde?
Der Regierungsvorschlag sieht 20 Maßnahmen vor. Mit diesen sollen Ausbildung, Arbeitsbedingungen sowie die Situation Betroffener und pflegender Angehöriger verbessert werden. Der größte Brocken entfällt auf den Gehaltsbonus. Bis Ende 2023 sollen Pflegekräfte einen Bonus in der Höhe eines zusätzlichen Monatsgehalts bekommen. Der Bund stellt dafür 570 Millionen Euro bereit. Nach einer Nachbesserung profitieren nun auch Heimhelfer:innen und Behindertenbetreuer:innen von dem Bonus. Dafür wurden die ursprünglich geplanten 520 Millionen Euro um 50 Millionen erhöht.
Welche Verbesserungen bringt die Pflegereform für Berufsein- und -umstieg?
Einsteiger:innen sollen einen monatlichen Ausbildungszuschuss von mindestens 600 Euro erhalten. Für jene, die Beruf wechseln, ist ab September 2023 ein Pflegestipendium von mindestens 1.400 Euro pro Monat geplant. Der Bund stellt dafür 225 Millionen Euro zur Verfügung. Das sind zwei Drittel der Kosten, das übrige Drittel müssen die Länder übernehmen. Mit der Reform kommt auch eine Pflegelehre. Sie soll im Schuljahr 2023/24 starten. Ein Abschluss ist nach drei Jahren als Pflegeassistenz, nach vier als Pflegefachassistenz möglich.
Wie will die Regierung die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals verbessern?
Pflege ist ein mental und körperlich fordernder Beruf. Neben dem Gehaltsbonus haben Pflegekräfte ab dem 43. Geburtstag daher Anspruch auf eine sogenannte Entlastungswoche – und damit eine zusätzliche Urlaubswoche. Pro Nachtdienst sollen Beschäftigte der stationären Langzeitpflege zudem eine Zeitgutschrift von zwei Stunden erhalten.
Mit welchen Maßnahmen können Pflegebedürftige rechnen?
Menschen mit schweren psychischen Behinderungen oder Demenz erhalten pro Monat 20 Stunden zusätzliche Pflege und Betreuung. Dafür wird der Wert des Erschwerniszuschlags von aktuell 25 auf 45 Stunden erhöht. Dieser Zuschlag gilt den Mehraufwand ab, der durch die Pflege dieser Personengruppen entsteht. Zudem wird die erhöhte Familienbeihilfe künftig nicht mehr auf das Pflegegeld angerechnet. Für Betroffene bedeutet dies 60 Euro mehr pro Monat.
Wie wirkt sich die Pflegereform auf die Situation pflegender Angehöriger aus?
Vier von fünf pflegebedürftigen Menschen werden von Angehörigen betreut. Ab Pflegestufe 4 soll jene Person, die die Hauptlast der Pflege trägt, einen Bonus von 1.500 Euro pro Jahr erhalten. Laut Entwurf wäre von diesem Bonus eine große Gruppe ausgeschlossen worden: Pensionist:innen, die ihre Angehörigen pflegen. Die Regierung hat daher nachträglich den Kreis der Bezieher:innen um das Dreifache erweitert. Statt 24.000 werden 74.000 Personen von dem Bonus profitieren.
Die Pflegestufen im Detail:
- Stufe 1 liegt bei einem Pflegebedarf von mehr als 65 Stunden pro Monat vor. Pflegegeld: 165,40 Euro.
- Stufe 2 liegt bei einem Pflegebedarf von mehr als 95 Stunden pro Monat vor. Pflegegeld: 305 Euro.
- Stufe 3 liegt bei einem Pflegebedarf von mehr als 120 Stunden pro Monat vor. Pflegegeld: 475, 20 Euro.
- Stufe 4 liegt bei einem Pflegebedarf von mehr als 160 Stunden pro Monat vor. Pflegegeld: 712,70 Euro
- Stufe 5 liegt bei einem Pflegebedarf von mehr als 180 Stunden pro Monat vor. Die pflegende Person muss zwar nicht durchgehend anwesend, dafür aber dauernd bereit sein. Pflegegeld: 968,10 Euro.
- Stufe 6 liegt bei einem Pflegebedarf von mehr als 180 Stunden pro Monat vor. Die Betreuungsmaßnahmen sind zeitlich nicht koordinierbar und werden sowohl am Tag als auch in der Nacht erbracht. Pflegegeld: 1351, 80 Euro.
- Stufe 7 liegt bei einem Pflegebedarf von mehr als 180 Stunden pro Monat vor. In diesem Fall kann die pflegebedürftige Person Arme und Beine nicht zielgerichtet bewegen oder es liegt ein vergleichbarer Zustand vor. Pflegegeld: 1776,50 Euro.
Finanzielle Unterstützung für Ersatzpflege ist künftig bereits nach drei Tagen möglich. Aktuell müssen pflegende Angehörige dafür mindestens eine Woche verhindert sein. Auch einen Rechtsanspruch auf Pflegekarenz von drei Monaten sieht die Reform vor. Das heißt: Berufstätige können sich freistellen lassen, um die Pflege ihrer Angehörigen zu organisieren. Voraussetzung ist, dass es nahe Angehörige wie Partner:innen, Kinder, Eltern sowie Cousins und Kusinen sind.
Gibt es auch Erleichterungen für Pflegekräfte aus dem Ausland?
Ausbildungen und Abschlüsse aus dem Ausland sollen schneller anerkannt werden. Für die Dauer dieses Verfahrens können Pflegekräfte aus dem Ausland als Pflegeassistenz oder Pflegefachassistenz arbeiten. Sie sollen auch die Rot-Weiß-Rot-Karte leichter bekommen. Diese brauchen all jene Drittstaatsangehörige, die in Österreich leben und arbeiten möchten. Sie gilt für 24 Monate. Gerade die Reisebeschränkungen der letzten zwei Jahre haben gezeigt, wie wichtig Pflegekräfte aus dem Ausland sind, um das System am Laufen zu halten.
Wie geht es nun weiter?
Der Nationalrat hat einen Teil der Reform noch vor der Sommerpause beschlossen. Teil dieses Pakets hätte auch der Angehörigenbonus sein sollen. Dieser wurde aber auf Herbst vertagt. Es braucht dafür eine Regierungsvorlage, die ermöglicht, dass auch Pensionist:innen diesen Bonus bekommen. Zudem arbeitet die Regierung derzeit daran, die unselbstständige 24-Stunden-Betreuung attraktiver zu gestalten.