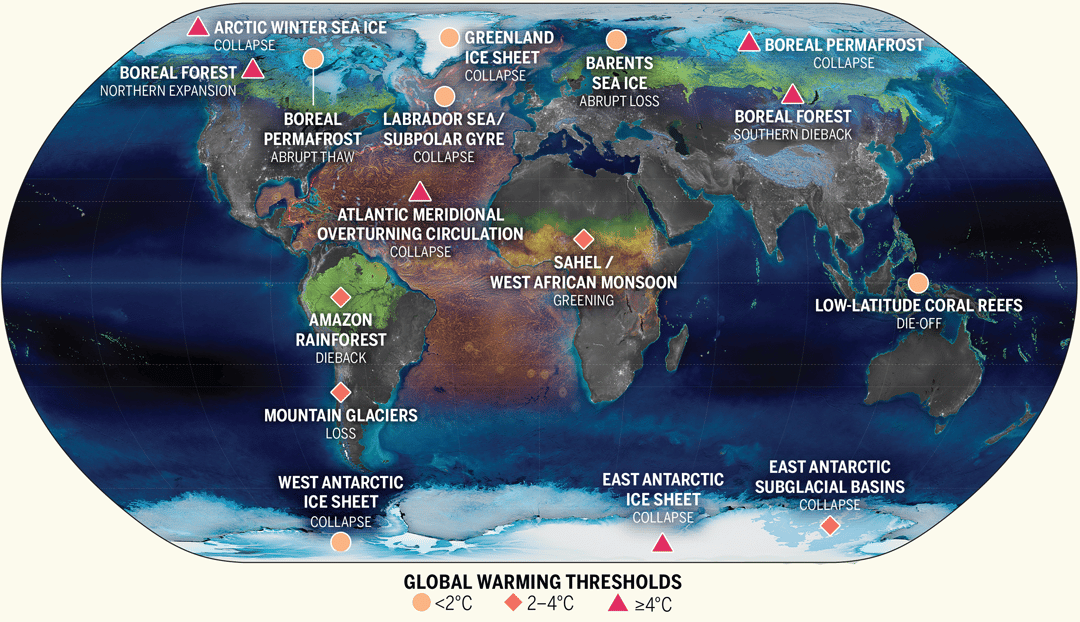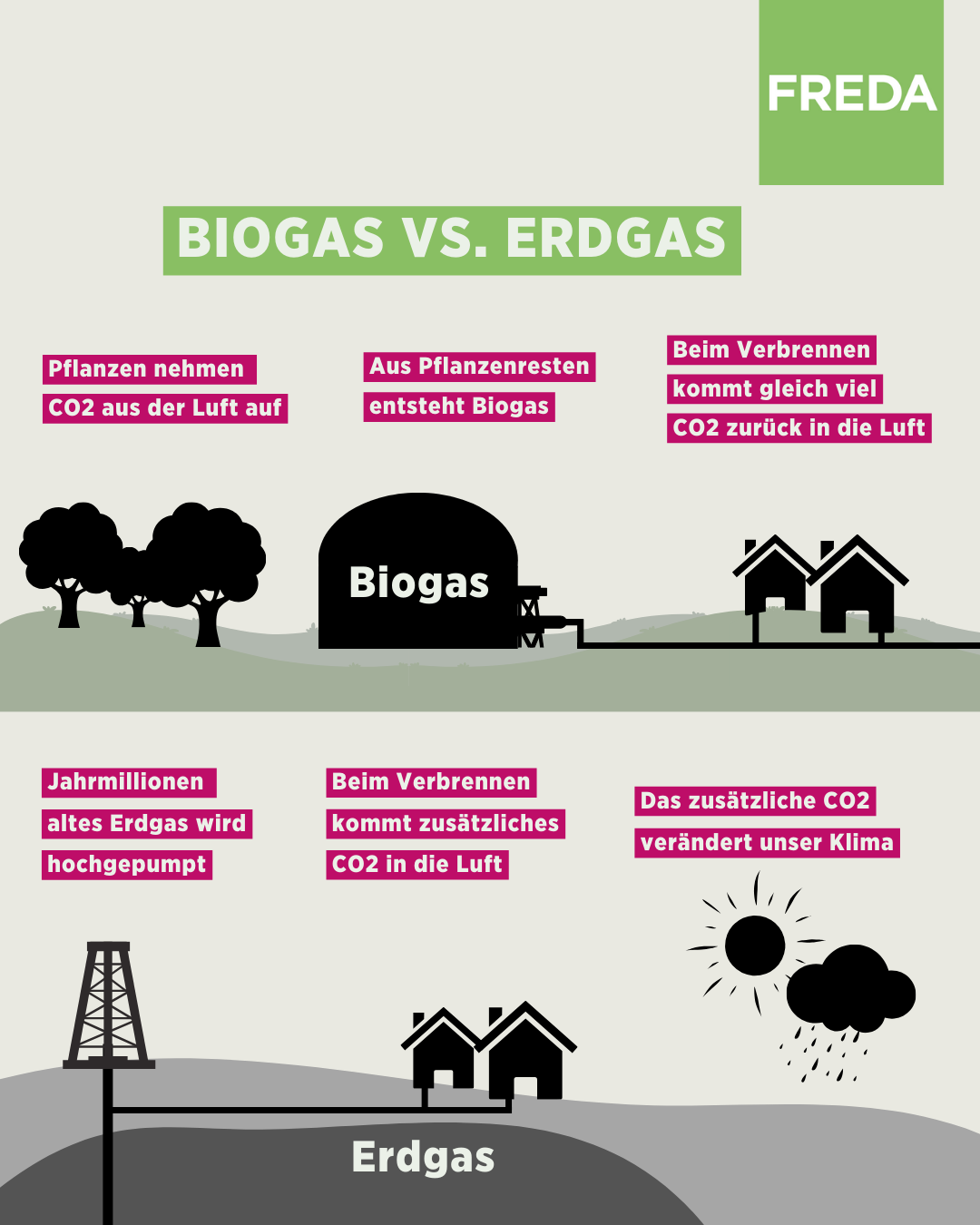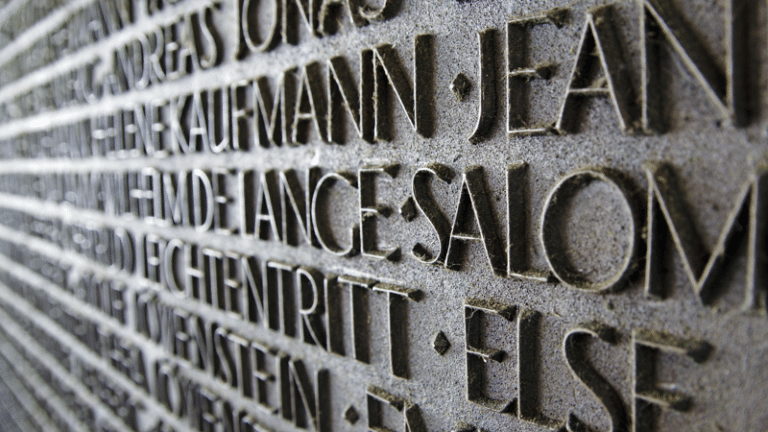Wir Frauen haben heute viele Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten. Das haben wir Feminist:innen zu verdanken, die diese in den letzten Jahrzehnten hart erkämpft haben. Das passt aber vielen Männern nicht. Sie wollen ihre Privilegien behalten und zurück zur traditionellen Rollenverteilung.
Wir Frauen haben heute so viele Entscheidungsfreiheiten wie noch nie zuvor. Unter anderem können wir selbst entscheiden, ob wir arbeiten gehen und müssen nicht mehr einen männlichen Verwandten um Erlaubnis bitten. Wir können heiraten, wen wir lieben, oder für immer Single bleiben. Und wenn wir ungewollt schwanger werden, können wir innerhalb der ersten drei Monate straffrei abtreiben.
Natürlich müssen wir noch viel tun, um echte Gleichstellung zu erreichen, aber Feminist:innen haben in der Vergangenheit bereits Vieles erkämpft. Und die weitere Entwicklung sollte eigentlich steil nach oben zeigen. Ein Erfolg folgt auf den anderen. Doch es gibt Gegenbewegungen, die genau das verhindern wollen. In Österreich und vielen anderen Ländern wollen Religiöse, Konservative und Rechtsextreme zurück zu traditionellen Rollenvorstellungen. Vater, Mutter, Kind – so habe laut ihnen eine Familie auszusehen. Ob das Frauen auch wollen? Irrelevant.
Männer verlieren Privilegien
Dass diese Gegenbewegung gerade in den letzten Jahren immer stärker geworden ist, sei kein Zufall, meint Autorin Susanne Kaiser. In ihrem Buch „Backlash“ schreibt sie, dass Frauen und sexuelle Minderheiten wie homo- und transsexuelle Menschen immer mehr Rechte erlangen. Die Vorstellung von Zweigeschlechtlichkeit, also dass es nur Frauen und Männer gebe, verliert dadurch an Bedeutung. Damit wird Männlichkeit zu einer Identität unter vielen. Und so verlieren Männer, die über Jahrhunderte als gesellschaftliche Norm gegolten haben, zunehmend ihre Privilegien.
Privilegien, die ihnen das Leben angenehm gemacht haben, gibt man sich so gerne her. Während Männer Macht verlieren, rücken Frauen in Machtpositionen vor. Das führt Männern ihre eigene Abhängigkeit vor Augen, argumentiert die Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach in ihrem Buch „Die Erschöpfung der Frauen“. Denn Frauen können Männer einfach die Fürsorge entziehen. Das heißt beispielsweise: Wenn der Mann nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt, wartet dort nicht das warme Essen, das die Frau davor extra zubereitet hat. „Diese Erfahrung des Wandels und der eigenen Fragilität oder auch Begehrensweisen wehren (manche) Männer ab, indem sie sich an bestimmte Ideen einer natürlichen heterosexuellen und binären Geschlechterhierarchie klammern und versuchen, damit ihre eigene Überlegenheit zu zementieren“, argumentiert Schutzbach.
Die Folge: Gewalt an Frauen steigt. Männer versuchen, den gesellschaftlichen Machtverlust auszugleichen, indem sie ihre Partner:innen schlagen oder ermorden, Hasskommentare unter Social Media-Beiträge von Frauen schreiben und versuchen Frauen aus dem öffentlichen Raum zurückzudrängen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenGegenbewegung ist auch politisch
Diese Gegenbewegung besteht nicht nur aus Männern, die sonntags nach der Kirche am Stammtisch sitzen und sich über Gendern und Frauen, die keine Kinder haben wollen, beschweren. Das Ganze hat eine politische Dimension. Konservative und rechtsextreme Politiker:innen wollen zum Beispiel statistisch erheben, warum Frauen abtreiben, fürchten sich vor Gendersternen und behindern den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen. Das ist in Österreich so und in vielen anderen Ländern auch.
Ein trauriges Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit: Die USA unter Präsident Donald Trump. Mit ihm ist Frauenfeindlichkeit ins Weiße Haus eingezogen. Und es ist ihm gelungen, die Rechte der Frauen einzuschränken. Zum Beispiel, indem er den Supreme Court, das Höchstgericht der USA, mit konservativen Richter:innen nachbesetzt hat. Und die haben dann 2022 das Abtreibungsrecht zurückgenommen. Seither können alle Bundesstaaten selbst entscheiden, ob sie Abtreibung erlauben oder nicht. Eine traurige Bilanz: 65.000 Vergewaltigungsopfer durften daher nicht abtreiben.
Backlash verhindern
„Einerseits ist das Patriarchat von der Idee her überwunden, faktisch aber eben nicht. Wenn der Staat den misogynen Hatern und Gewalttätern nicht den Nährboden entzieht, sondern einfach das Terrain überlässt, egal ob im Netz, auf der Straße oder zu Hause, dann formieren diese einen gewalttätigen Backlash gegen den verhassten Aufstieg von politischen Minderheiten, allen voran Frauen. Je steiler ihr Aufstieg, je sichtbarer sie werden, besonders in Machtpositionen, desto krasser der Backlash“, schreibt Kaiser in ihrem Buch. Diesen Backlash gilt es zu verhindern.
Das beginnt bereits bei der Erziehung. Wir sagen kleinen Mädchen, dass sie alles werden können, was sie wollen. Aber wir vergessen vielfach immer noch, den Burschen klarzumachen, dass die Welt ihnen nicht alleine gehört. Dafür braucht es Bildungsangebote, die schon im Kindergarten beginnen.
Wir müssen auch aufhören, Gewalt gegen Frauen kleinzureden. Das ist kein individuelles Problem. Das ist kein aus dem Ausland importiertes Problem. Jede Frau kann betroffen sein und die Täter kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Es ist ein strukturelles Problem und damit tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Und es braucht endlich wirksame Maßnahmen, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern.
Die Gegenbewegungen sind eine Reaktion auf die feministischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte. Aber wir brauchen nicht weniger Gleichberechtigung, sondern mehr davon. Die Arbeit aller Menschen ist gleich viel wert. Alle Menschen sind unabhängig von ihrem Geschlecht medizinisch gut versorgt. Gewalttäter werden zur Verantwortung gezogen. Diese Gesellschaft soll nicht länger Utopie sein.