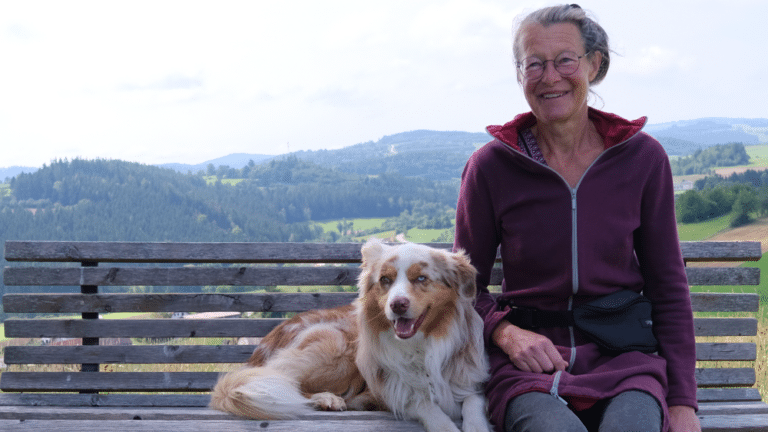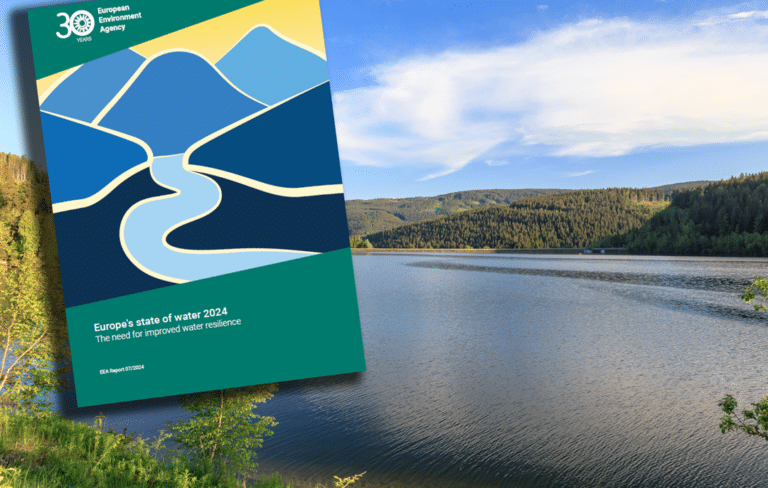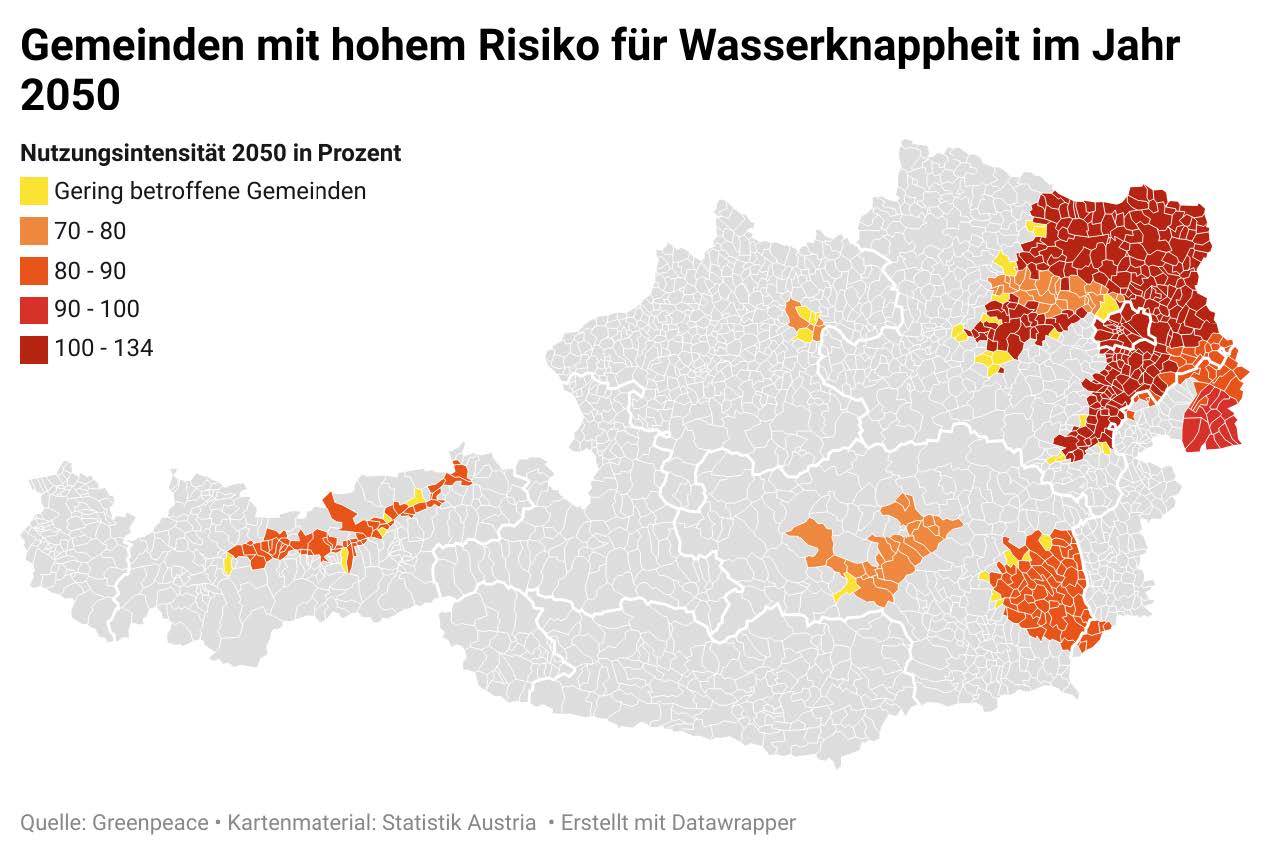Die Klimakrise bringt uns immer häufiger kurze und milde Winter. Darunter leiden auch unsere heimischen Tierarten. Denn die steigenden Temperaturen führen dazu, dass Winterschläfer früher aus ihrem Winterschlaf erwachen. Das führt zu Problemen.
Wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen, der erste Schnee kommt und der Boden gefriert, wird es im Wald still. Die Tiere ziehen sich zum Winterschlaf zurück. Erst mit den ersten warmen Sonnenstrahlen im Frühling erwacht die Natur wieder zum Leben. So sollte es sein. Doch was, wenn es dem Murmeltier in seiner Höhle plötzlich zu warm wird? Bienen aus ihrer Winterstarre zu früh erwachen, weil draußen scheinbar die ersten Blumen in der Blüte stehen? Oder der Igel durch Wärmeperioden aus seinem Rhythmus gebracht wird? Vom ungestörten Winterschlaf ist da oft nur noch wenig übrig.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenWelche Auswirkungen haben milde Winter auf unsere heimischen Tier- und Pflanzenarten? Wie gehen sie mit der Klimawandel und den steigenden Temperaturen im Winter um? Universitätsprofessorin Claudia Bieber von der Veterinärmedizinischen Universität Wien verrät uns, wie heimische Tierarten den Winter verbringen und wie wir ihnen dabei helfen können.
Winterschlaf, Winterstarre & Winterruhe
„Tiere haben verschiedene Strategien, um den Winter zu überstehen, abhängig von ihrer Spezies, Umgebung und den verfügbaren Ressourcen“, erklärt die Professorin. Einige Vögel fliegen im Winter Richtung Süden, um die kalte Jahreszeit in warmen Regionen zu verbringen. Eine Reise in warme Gefilde ist jedoch nicht jedem Tier möglich, weshalb sich andere an die winterlichen Bedingungen anpassen, indem sie Winterschlaf, Winterruhe oder Winterstarre halten.
Winterschlaf: Beim Winterschlaf senken Tiere ihre Körpertemperatur und alle Lebensfunktionen drastisch ab. Die Herzfrequenz sinkt auf nur wenige Schläge pro Minute, die Atmung wird langsamer, und die Muskeln werden schlaff. Dadurch verbrauchen die Tiere nur noch sehr wenig Energie. Winterschläfer sind meist kleine Tiere, die nicht genug Nahrung finden, um den Winter zu überleben. Dazu gehören Fledermäuse, Siebenschläfer, Hamster, Murmeltiere und Igel.
Winterruhe: Bei der Winterruhe senken Tiere ihre Körpertemperatur nicht so stark wie bei der Winterstarre. Es ist ein Zustand, den man sich als mehrfach unterbrochenen Winterschlaf vorstellen kann, bei dem hin und wieder gefressen wird. Winterruhe halten meist größere Tiere. Dazu gehören Dachse, Eichhörnchen, Waschbären und Braunbären.
Winterstarre: Bei der Winterstarre lässt sich das Tier vollständig einfrieren. Die Körpertemperatur sinkt bis auf den Gefrierpunkt, die Atmung und die Herzfrequenz hören auf. In diesem Zustand verbrauchen die Tiere kaum noch Energie. Um sich vor Frost zu schützen, vergraben sich die Tiere häufig im Boden. Erst wenn es wieder wärmer wird, ist die Winterstarre vorbei. Das bedeutet, dass die Tiere zwischendurch nicht aufwachen können und daher auch nicht fressen. Winterstarre findet man bei wechselwarmen Tieren wie Fröschen und Schildkröten.
Neben dem Winterschlaf, der Winterruhe und -starre gibt es noch weitere Strategien, die die Tiere durch den Winter bringen. „Eichhörnchen halten beispielsweise keinen Winterschlaf. Sie legen im Herbst einen Futtervorrat an, der sie den Winter über ernährt. Andere Tiere fressen im Herbst Unmengen, um sich eine Speckschicht anzulegen. Wieder andere Säugetiere oder Vögel legen sich in der kalten Jahreszeit ein Winterfell oder ein dickes Federkleid zu“, erklärt die Professorin. Für sie haben die steigenden Temperaturen keine großen Auswirkungen. Denn ein wärmerer Winter bedeutet für sie mehr Nahrung. Für alle anderen jedoch bedeuten die höheren Temperaturen Stress und Gefahr.

Auswirkungen der Klimakrise auf die Winterruhe
- Einfluss auf Insekten: Am schwersten fällt es den Insekten, sich auf die veränderten Temperaturen einzustellen. Denn Insekten sind auf den Nektar verschiedener Pflanzen angewiesen. Durch die warmen Winter blühen viele Pflanzen frühzeitig, manchmal zu früh. Viele Insekten sind da noch nicht aktiv. Dies führt dazu, dass Bienen und andere Insekten, wenn sie fliegen, oft keine Nahrung mehr finden, da die Blüten bereits verblüht sind. Dies ist besonders für Bienen problematisch, da sie dadurch verhungern können. Ein vorgetäuschter Frühlingsbeginn kann zudem Insekten frühzeitig aus ihren sicheren Nestern locken. Bienen verlassen beispielsweise ihren Bienenstock ab zwölf Grad Celsius, suchen nach Nahrung und Wasser, räumen ihr Winterquartier auf und beginnen mit ihrer Arbeit, was viel Energie kostet. Wenn dann nur wenige Blüten verfügbar sind, erhalten einige Bienen nicht genug Nahrung und verhungern. Bei plötzlichem Kälteeinbruch während eines Ausflugs schaffen es einige Bienen möglicherweise nicht mehr rechtzeitig zurück und erfrieren. Der Verlust dieser erfrorenen Bienen kann erhebliche Auswirkungen auf das gesamte Leben im Bienenstock haben.
- Einfluss auf Pflanzen: Die Winter werden wärmer, die Tage länger, und viele Pflanzen blühen jedes Jahr früher. Wenn dann keine Insekten für die Bestäubung bereitstehen, kann das langfristig zu weniger Früchten führen. Auch die Frosthärte von Pflanzen ist betroffen. Einige Pflanzen, die früher frostbeständig waren, sind nun anfälliger für Frostschäden, weil sie nicht mehr so gut auf Kälte vorbereitet sind. Dies kann dazu führen, dass Pflanzen erfrieren oder ihre Blätter verlieren, was ihre Gesundheit und Produktivität beeinträchtigt.
- Verhalten von Vögeln: Zugvögel fliegen üblicherweise im Herbst in wärmere Regionen, um zu überwintern. Bei milden Wintern entscheiden sich jedoch mehr Vögel, in der Region zu bleiben, da sie hier länger Nahrung wie Insekten finden können. Das führt zu Konkurrenz um Nahrung und Lebensraum mit Vögeln, die das ganze Jahr über in Österreich bleiben. Außerdem könnten Zugvögel, die normalerweise nach Afrika fliegen und im Frühling zurückkehren, mit besetzten Nistplätzen konfrontiert werden.
- Auswirkungen auf Säugetiere: Die Population von Säugetieren wie Wildschweinen und Rehen könnte aufgrund des milden Wetters ansteigen. Während sich diese Tiere anpassen können, birgt plötzlicher Frost Gefahren für Jungtiere, die erfrieren oder verhungern könnten.
- Problematischer Winterschlaf: Milde Winter können unterschiedliche Auswirkungen auf den Winterschlaf von Tieren haben. Winterschläfer wie Igel, Fledermäuse oder Bilche werden durch einen durchgängig milden Winter kaum gestört. Dauert die milde Phase jedoch länger an und wird dabei häufig von kurzfristigen Kälteeinbrüchen unterbrochen, wachen Winterschläfer auf und benötigen im Wachzustand wesentlich mehr Energie. Das bedeutet mehr Nahrung, welche nicht ausreichend zu finden ist. Kommt es dann erneut plötzlich zu einem Kälteeinbruch, geraten die Winterschläfer in Gefahr zu erfrieren oder zu verhungern.
- Auswirkungen auf die Nahrungskette: Selbst die globale Nahrungskette kann durch mildere Winter beeinträchtigt werden. Zugvögel zum Beispiel überwintern normalerweise im wärmeren Süden und dienen dort wiederum einheimischen Tieren als Nahrungsquelle. Wenn diese Zugvögel jedoch ihre Reise im Herbst nicht antreten, kann das zu Nahrungsmangel im Süden führen. Darüber hinaus stellen die höheren Temperaturen auch eine Herausforderung für einheimische Vögel dar, die auf das Aufknacken von gefrorenen Samen angewiesen sind. Gefrorene Samen sind dann Mangelware.

Maßnahmen zum Schutz der Tiere in milderen Wintern
Mit ein paar einfachen Tipps können wir Tieren helfen, den Winter besser zu überstehen. Professor Bieber rät zu folgenden Maßnahmen:
- Futter bereitstellen: Stellt zusätzliche Nahrungsmittel bereit, um sicherzustellen, dass Tiere genügend Energie haben, um die kälteren Perioden zu überstehen. Dies gilt insbesondere für Wildtiere, Vögel und streunende Tiere.
- Wasserversorgung: Sorgt dafür, dass Tiere Zugang zu sauberem Wasser haben. In milderen Wintern kann es vorkommen, dass natürliche Wasserquellen einfrieren, was die Wasserversorgung für Tiere erschwert.
- Schutzräume: Bietet Unterschlupf- und Schutzmöglichkeiten für Tiere an. Das können Nistkästen für Vögel, Verstecke für Kleintiere oder geschützte Bereiche für Wildtiere sein.
- Heimische Pflanzen fördern: Setzt in Gärten Pflanzen an, die in eurer Region heimisch sind und den Tieren als Nahrung dienen. Das unterstützt die örtliche Tierwelt und hilft, das Gleichgewicht in der Natur zu erhalten.
- Waldruhe: Viele Tiere halten im Wald ihre Winterruhe. Stört sie nicht mit Lautstärke und bleibt auf Wegen und Wintersportpisten.
- Klimaschutz unterstützen: Setzt euch für Klimaschutzmaßnahmen ein, um die Auswirkungen der Klimakrise auf die Tierwelt zu reduzieren. Zum Beispiel durch das Reduzieren des persönlichen CO₂-Fußabdrucks, das Vermeiden von Plastikmüll und das Unterstützen von Initiativen zur Förderung erneuerbarer Energien.
- Aufklärung und Sensibilisierung: Informiert Familie, Freunde, Gemeinde über die Auswirkungen der Klimakrise auf die Tierwelt. Ermutigt sie dazu, die Natur und das Klima aktiv zu schützen.
- Forschung fördern: Unterstützt wissenschaftliche Forschung, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Tierwelt befasst. Dies kann dazu beitragen, fundierte Maßnahmen zur Unterstützung von Tieren in milderen Wintern zu entwickeln.
- Naturschutzgebiete schützen: Engagiert euch für den Erhalt und Ausbau von Naturschutzgebieten, um intakte Lebensräume für Tiere zu bewahren.