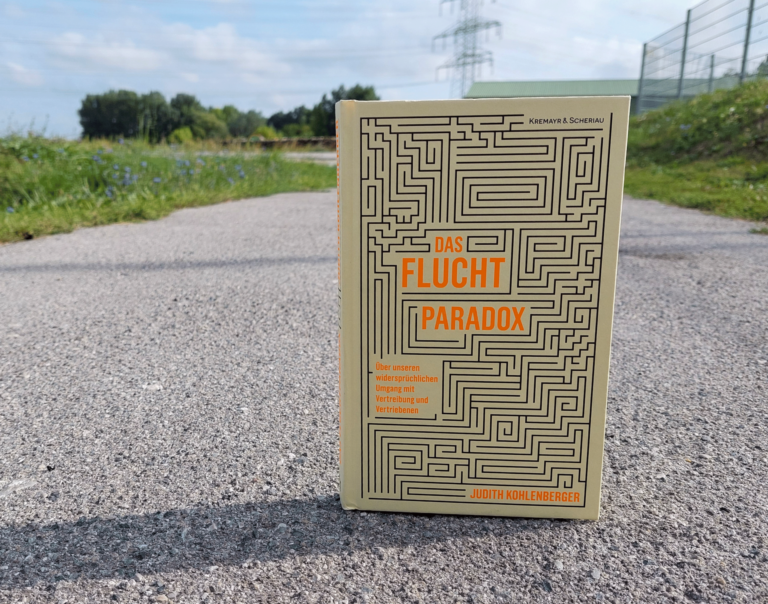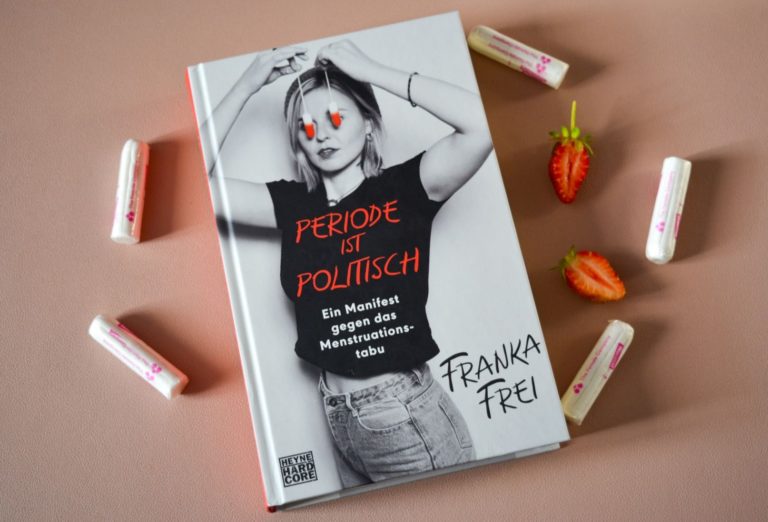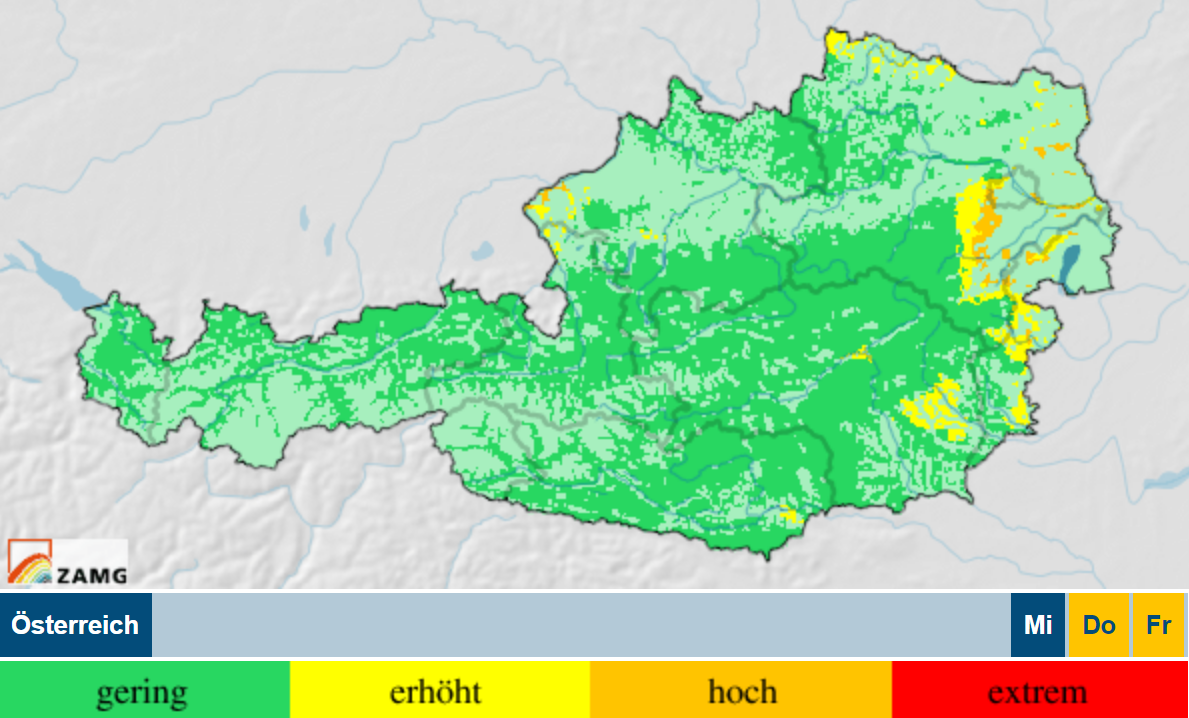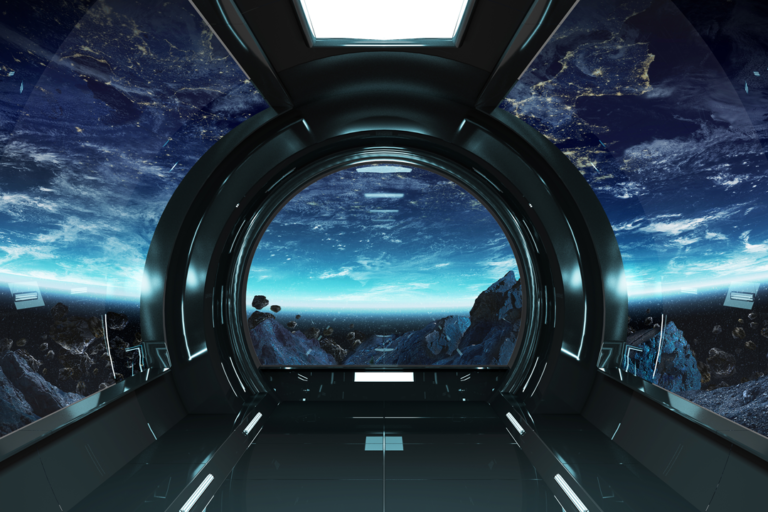Hass im Netz kann jede:n treffen. Frauen, vor allem jene mit starker Meinung, trifft er aber auf einer persönlicheren Ebene und die Hassnachrichten sind viel sexualisierter. Das wirkt sich auf die Art, wie sich Frauen im Internet äußern, aus.
Sie sind jung, weiblich und vertreten eine starke Meinung in den sozialen Medien. Sie äußern sich öffentlich zu polarisierenden Themen wie Feminismus, Rassismus, Klimawandel und die Corona-Impfung. Und sie werden genau dafür angefeindet. Sie werden beschimpft. „Schlampe“. „Aufmerksamkeitshure“. Mit rassistischen Begriffen. Ihnen werden Vergewaltigungen gewünscht und sie erhalten Morddrohungen.
Hassnachrichten sind sexualisierter
Hass im Netz kann alle treffen. Doch Frauen werden viel persönlicher und sexualisierter angegriffen. Sie bekommen nicht ein, zwei gemeine Nachrichten, ihnen schlägt geballter Hass entgegen. Noch stärker angefeindet werden sie, wenn sie LGBTIQ+ sind oder einer Minderheit angehören. Sie erfahren Hass in unterschiedlichsten Formen: von Beleidigungen über erfundene Aussagen und Drohungen bis hin zu Doxxing. Bei Letzterem werden persönliche Daten wie Adresse und Beruf im Internet veröffentlicht. Opfer müssen Angst haben, dass ihnen vor der eigenen Wohnung oder am Weg zur Arbeit jemand auflauert. Denn das ist auch ein Problem mit Hass im Netz: Er kann in die Offline-Welt überspringen.
Frauen werden eingeschüchtert
Das Ziel von Hass im Netz: selbstbewusste Frauen mundtot machen. Silencing lautet der Fachbegriff. Betroffene werden belästigt und bedroht. Zum Beispiel, indem Unbekannte ihnen E-Mails mit detailliert beschriebenen Vergewaltigungsszenen schicken. Das soll sie einschüchtern und aus der Debatte drängen. Es gibt Frauen, die sich danach mehrmals überlegen, was sie posten und ob sie überhaupt noch einmal etwas posten. Aus Angst vor noch mehr Hass. Manchmal löschen Betroffene ihre Social Media-Konten. So wie Schauspielerin Mavie Hörbiger. Weil sie bei den Salzburger Festspielen ohne BH und mit erkennbaren Brustwarzen unter ihrem T-Shirt fotografiert wurde, erntete sie Hass. „Warum könnt ihr den Festspielen nicht die Würde verleihen, die jenes Kulturereignis großgemacht hat? Ein Jedermann, der zum JederGender verkommt – Kleidungsstil, der so zu Woodstock passt, Frauen ohne BH – nur, um sich aufzuregen, dass ihnen Männer auf den Busen glotzen. Kultur Over“, lautete eine Nachricht. Hörbiger konterte: „Wenn du meine Nippel durch das Shirt siehst, dann weil ich ein Mensch bin und welche habe. Ihr müsst mich nicht drauf hinweisen. Ich kenne meinen Körper.“ Danach hat sie ihren Twitter-Account deaktiviert.
Frauen diskutieren seltener mit
Silencing hat Konsequenzen. Die Hälfte der Frauen äußert sich aus Angst vor Drohungen und Angriffen seltener im Internet. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von HateAid, einer deutschen Beratungsstelle für Betroffene von digitaler Gewalt. Dass die Täter:innen meist anonym sind, macht den Opfern zusätzlich zu schaffen. Eine Umfrage des Kinderhilfswerks Plan International zeigt, dass Mädchen und junge Frauen deshalb ihr Verhalten anpassen und mehr darauf achten, wie sie ihre Meinung im Internet äußern.
Der Fall Lisa Maria Kellermayr zeigt auf drastische Weise, wozu Hass im Netz führen kann. Die oberösterreichische Ärztin hat sich unermüdlich für die Corona-Impfung starkgemacht und Demonstrationen von Corona-Leugner:innen vor Krankenhäusern verurteilt. Ein:e Unbekannte:r hat ihr deshalb über Monate hinweg Todesdrohungen geschickt. Kellermayr hat laut Staatsanwaltschaft Suizid begangen.
Mehr Hass, wenn sich Frauen wehren
Es gibt Frauen, die dagegenhalten. Die den Hass, mit dem sie konfrontiert werden, aufzeigen. Und dafür meistens noch mehr Hass abbekommen. So wie Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl, die gegen Rechtsextremismus auftritt und dafür seit Jahren Hass zu spüren bekommt. Zuletzt nach dem Tod von Kellermayr. „du grindige hur! wann machst du jetzt endlich die kellermayr? schaden würds nicht wenn man dich auch eines morgens tot auffinden würde“, schrieb ihr jemand. Auch sie hat ihren Twitter-Account vorübergehend deaktiviert.
Betroffene ernst nehmen
Das Internet ist ein Ort des Austauschs. Dafür muss es aber auch für alle Nutzer:innen ein sicherer Ort sein. In Österreich ist 2021 das Gesetz gegen Hass im Netz in Kraft getreten. Unter anderem müssen Plattformen wie Facebook, Twitter und Telegram einfache Möglichkeiten bieten, um rechtswidrige Inhalte zu melden und zu löschen. Um ihnen Klagen sicherzustellen zu können, müssen sie zudem eine zustellungsberechtigte Person innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums haben. Die Opfer von Hass im Netz können zudem eine kostenlose Prozessbegleitung in Anspruch nehmen. Es gibt Angebote zur psychologischen Betreuung, Opfer von Hass im Netz können sich auch zu Polizei und Gericht begleiten und vor Gericht von einem:r kostenlosen Rechtsanwält:in vertreten lassen. Auch die Beratungsstelle #GegenHassimNetz unterstützt Opfer, gegen Hassnachrichten vorzugehen.
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es also. Es kommt aber vor, dass die Behörden Opfer nicht ernst nehmen oder die Täter:innen nicht ausforschen. Weil Ressourcen, Kompetenzen oder Sensibilität fehlen. Das dürfte auch bei Lisa Maria Kellermayr der Fall gewesen sein. Strobl hat von der Staatsanwaltschaft die Rückmeldung bekommen, es würde kein Anfangsverdacht bestehen. Ein Problem sind auch die Plattformen, die Hassposts nicht immer löschen. Mit dem im Juli beschlossenen Digital Services Act will sie nun auch die EU mehr zur Verantwortung ziehen. Sie müssen unter anderem stärker gegen Hass- und Falschnachrichten sowie andere illegale Inhalte vorgehen.
Demokratie lebt von Meinungsvielfalt
Hass im Netz muss stärker bekämpft werden. Dafür braucht es aber nicht nur rechtliche Rahmenbedingungen. Es braucht auch mehr Rücksicht im Internet. Nur, weil die Kommentarspalte unter einem Post unpersönlich wirkt, bedeutet das nicht, dass die Nachricht, die man eintippt, bei keinem Menschen ankommt. Jede:r Einzelne kann darauf achten, respektvoll zu bleiben. Denn, wenn Frauen aus berechtigter Angst vor Hassreaktionen sich aus dem digitalen Raum zurückziehen, können sie ihr Recht auf Meinungsäußerung nicht entsprechend nutzen. Hören sie auf oder beginnen gar nicht erst, sich an der digitalen Debatte zu beteiligen, geht zudem eine wichtige Perspektive verloren. Ideen, über die nicht gesprochen wird, erhalten auch keine Aufmerksamkeit. Sie werden nicht wahrgenommen. Doch gerade eine Demokratie lebt von Meinungsvielfalt.
Menschen, die Hass im Netz erfahren, in Krisensituationen oder mit Suizid-Gedanken können sich an eine Reihe von Hilfseinrichtungen wenden:
- Opfernotruf vom Justizministerium in Zusammenarbeit mit dem Weißen Ring (0-24 Uhr): 0800/ 112 122, opfer-notruf.at
- Psychiatrische Soforthilfe (0–24 Uhr): 01/313 30
- Kriseninterventionszentrum (Mo–Fr 10–17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at
- Rat und Hilfe bei Suizidgefahr, pro mente Oberösterreich 0810/97 71 55
- Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79
- Telefonseelsorge (0–24 Uhr, kostenlos): 142
- Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder und Jugendliche): 147
- Gesprächs- und Verhaltenstipps für Angehörige: bittelebe.at