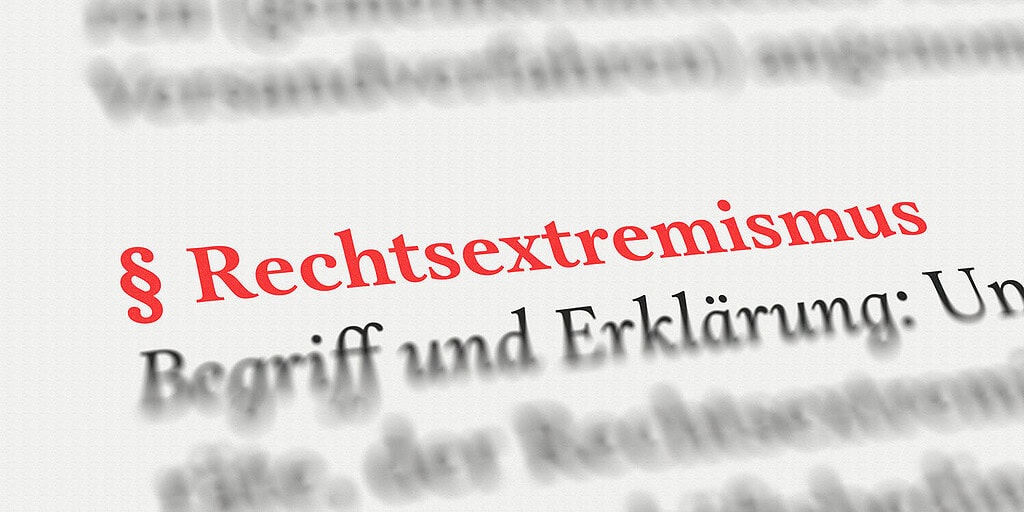Jede Frau, die Gewalt erfährt, ist eine zu viel
Gewalt an Frauen zählt weltweit zu den häufigsten Menschenrechtsverletzungen und bleibt dennoch oft ungesehen. Die Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ macht jedes Jahr ab 25. November auf dieses Problem aufmerksam. Die Daten zeigen: Auch in Österreich erleben viele Frauen Gewalt, während unser Rechtssystem große Lücken bei sexualisierter Gewalt aufzeigt. Über die Kampagne und warum sich politisch und gesellschaftlich etwas ändern muss.
Die Zahlen sprechen für sich: Jede dritte Frau weltweit ist im Laufe ihres Lebens von körperlicher, psychischer oder sexualisierter Gewalt betroffen. Aber nicht etwa von fremden Menschen, sondern häufig durch vertraute Personen. Ex-Partner, Partner, Familienmitglieder oder Personen aus dem unmittelbaren Umfeld sind bei einem Großteil der Fälle die Täter. Von häuslicher Gewalt, über Stalking bis hin zu Femiziden: Viele Betroffene suchen keine Hilfe. Aus Angst, Abhängigkeit, Scham oder fehlendem Vertrauen in bestehende Strukturen. Gleichzeitig zeigt sich, wie tief verankert diese Unsicherheit auch im Alltag vieler Frauen ist: Am Heimweg den Schlüssel zwischen den Fingern, die Straßenseite wechseln, im Dunkeln nicht mehr durch Parks gehen. Diese Vorsicht ist keine Einzelwahrnehmung, sondern Ausdruck eines strukturellen Problems.
16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen
Die internationale Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ findet jedes Jahr vom 25. November – dem Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden – bis 10. Dezember – dem internationalen Tag der Menschenrechte – statt. Dieser Zeitraum wird weltweit genutzt, um das Ausmaß und die verschiedenen Ausprägungen von Gewalt gegen Frauen zu thematisieren.
Der Gedenktag am 25. November geht zurück auf die drei Schwestern Mirabal. Sie kämpften gegen das Regime des Diktators Rafael Trujillo. 1960 wurden sie in der Dominikanischen Republik vom Geheimdienst entführt, gefoltert und ermordet. 1981 riefen Aktivistinnen ihr Todesdatum zum Gedenktag für alle Opfer von Gewalt an Frauen und Mädchen aus. 1991 lief erstmals die Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. Seit 1999 ist der 25. November auch von den Vereinten Nationen offiziell als internationaler Gedenktag anerkannt.
Mittlerweile beteiligen sich jährlich über 6000 Organisationen in 187 Ländern. Unter dem Hashtag #orangetheworld werden berühmte Gebäude orange beleuchtet, Veranstaltungen organisiert und Aufklärungsarbeit geleistet.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenDie Zahlen in Österreich sind alarmierend
Politische Veränderung braucht es auch in unserem Land. Laut AÖF ist jede dritte Frau in Österreich von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen. Jede vierte Frau muss eine Form von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz erfahren, und jede Fünfte ist von Stalking betroffen. Doch dem nicht genug: 2025 wurden bisher bereits 14 Frauen ermordet und 32 schwer verletzt (Stand November 2025).
Das „Nur Ja heißt Ja“-Prinzip
„Warum hast du dich nicht gewehrt?“ Eine Frage, die Opfer von sexualisierter Gewalt oft hören müssen. Doch viele können in einer bedrohlichen Lage kein deutliches Nein aussprechen. Derzeit ist im österreichischen Sexualstrafrecht das „Nein heißt Nein“-Prinzip verankert. Die sexuelle Selbstbestimmung wird dann verletzt, wenn gegen den Willen einer Person der Beischlaf oder eine dem Beischlaf gleichzusetzende geschlechtliche Handlung vorgenommen wird. Eine Reaktion von Opfern wird aber nicht berücksichtigt: Viele Menschen können kein klares Nein mehr ausdrücken. Sie verfallen in eine Schockstarre und können sich weder körperlich noch verbal wehren.
Geht es nach den Grünen, soll sich das bald ändern. Im Zentrum der aktuellen Debatte steht das Zustimmungsprinzip „Nur Ja heißt Ja“. Sexuelle Handlungen sind damit nur dann einvernehmlich, wenn alle Beteiligten aktiv zustimmen. Damit werden sie nicht erst strafbar, wenn Gewalt oder Druck nachweisbar sind, sondern, auch wenn es keine aktive und freiwillige Zustimmung gab.
Wo das Zustimmungsgesetz bereits gilt
Zahlreiche europäische Länder haben „Nur Ja heißt Ja“ bereits umgesetzt: Spanien, Schweden, Norwegen, Frankreich, Slowenien, Belgien, Luxemburg – um nur einige zu nennen. Vor allem Schweden, das 2018 als erstes Land voranging, liefert eindrucksvolle Daten: Seit Einführung des Gesetzes enden Fälle, in denen früher oft zugunsten des Beschuldigten entschieden wurde, nun in Anklagen und Verurteilungen. Und auch die Zahl der Anzeigen stieg. Ein Zeichen dafür, dass Betroffene weniger Angst haben, sich an Behörden zu wenden. Österreich zählt damit zu den Ländern, die im europäischen Vergleich nachhinken und endlich aufholen müssen.
Wo Betroffene Hilfe finden
Politische Reformen brauchen viel Zeit. Aber Hilfe muss sofort verfügbar sein. In Österreich gibt es mehrere zentrale Anlaufstellen, die anonym, kostenlos und vertraulich rund um die Uhr erreichbar sind.
• Frauenhelpline: 0800 222 555
• IFS Frauennotwohnung: 051555 577
• Telefonseelsorge: 0800 567 567
• 24h-Frauennotruf Wien: 01 71 71 9
• Notruf der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22
Diese Stellen bieten Beratung, Krisenhilfe und vermitteln auf Wunsch an Gewaltschutzzentren oder Frauenhäuser weiter.
Wir alle sind gefragt
Gewalt lässt sich nicht allein durch Gesetze verhindern. Um wirklich etwas zu ändern, müssen wir als Gesellschaft umdenken und ein Umfeld schaffen, das den Betroffenen glaubt und sie unterstützt. Wir alle können ein starkes Zeichen gegen Gewalt setzen:
- Problematische Rollenbilder hinterfragen
- Betroffenen ohne Druck zuhören und ernst nehmen
- Sexualisierte Gewalt klar benennen
- Prävention an Schulen und in der Öffentlichkeit
- Diskussionen starten und sich beteiligen
- Gewalt nicht als „Privatsache“ gelten lassen
„16 Tage gegen Gewalt“ erinnert uns jedes Jahr daran, dass Gewalt an Frauen kein Randthema ist, sondern ein tief verankertes strukturelles Problem. Es zeigt uns aber auch, dass wir alle besser hinschauen, hinhören und helfen müssen. Frauen müssen in Sicherheit leben können, im öffentlichen Raum, online, zu Hause und in Beziehungen. Ein Leben ohne Angst darf kein Privileg sein. Es muss ein Recht sein.