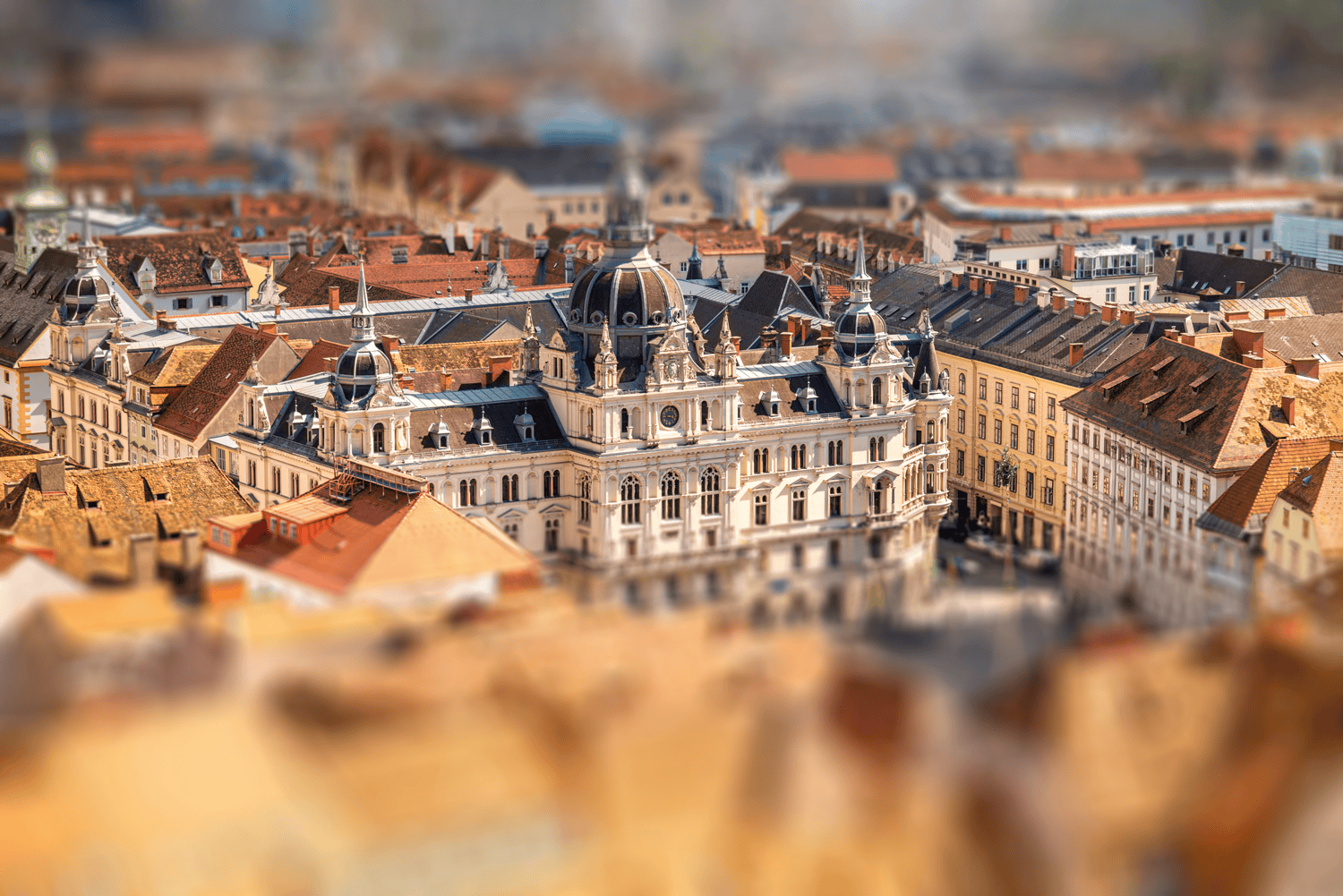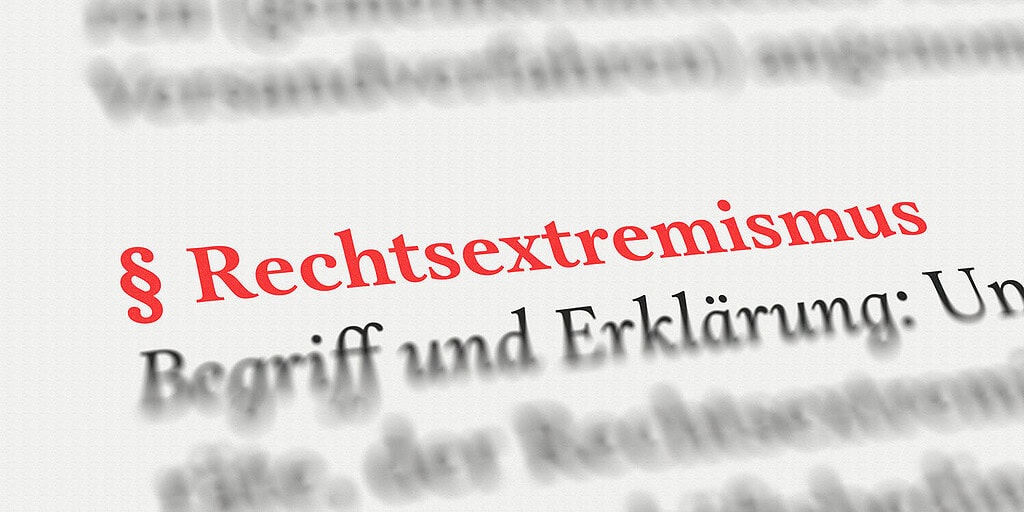Ist das Stadtleben wirklich besser fürs Klima?
Städte sind für rund drei Viertel der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich. Trotzdem hören wir immer wieder, dass das Leben in Städten am besten fürs Klima ist. Was denn jetzt? Stadt, Land, Vorstadt, wo lebt es sich am klimafreundlichsten? Die Antwort ist überraschend.
Dein Leben verursacht klimaschädliche Gase, allen voran CO₂. Das kannst du nicht ändern, egal, wie sehr du dich bemühst. Die Menge kannst du aber sehr wohl beeinflussen. Indem du wenig Fleisch isst, nicht Auto fährst und mit dem Zug verreist, zum Beispiel. Aber all das hast du sicher schon oft gehört.
Worüber wir aber selten sprechen: Auch die Wahl deines Wohnortes kann eine Rolle spielen. Expert:innen ordnen die Wohnorte von Menschen drei Kategorien zu. Die Stadt, die Vorstadt, in Österreich auch oft Speckgürtel genannt, und das Land. Bist du vielleicht gar dazu verdammt, viele Emissionen auszustoßen, einfach nur, weil du am Land lebst? Schauen wir uns das genauer an.
Wohnungsgröße
In Städten wohnen die meisten Menschen in kleineren Wohnungen, in der Vorstadt und am Land hingegen in Häusern mit mehr Wohnfläche. Warum macht das bei der Klimabilanz einen Unterschied? Ein großes Haus oder eine große Wohnung bedeutet mehr Heizfläche und mehr Stromverbrauch. Wenn du mehr Zimmer hast, hast du in der Regel auch mehr Haushaltsgeräte.
Im ländlich geprägten Burgenland haben Menschen durchschnittlich 126,4 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, in der Großstadt Wien sind es hingegen nur 74,5 Quadratmeter.
Aber mehr noch als um Strom geht es um das Heizen. Für deine Klimabilanz ist das Heizen ein entscheidender Faktor, der oft ein Drittel deines CO₂-Ausstoßes ausmachen kann. Daher wirken sich eine große Wohnfläche negativ auf deine persönliche Klimabilanz aus.
Verfügbarkeit von Öffis
Viele Städte in Österreich verfügen über ein gut ausgebautes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln. Das macht es leicht für dich, ohne Auto durch den Alltag zu kommen und damit den eigenen CO₂-Ausstoß zu senken.
Im ländlichen Burgenland gibt es pro 1.000 Einwohner:innen 614 Privatautos. In Wien hingegen sind es nur 284 Privatautos pro 1.000 Einwohner:in. Auch Innsbruck (333 Privat-Pkw pro 1.000 Personen) und die Stadt Salzburg (383) haben ähnliche Zahlen vorzuweisen.
Da der öffentliche Nahverkehr in vielen ländlichen Regionen seltener fährt oder bestimmte Gebiete gar nicht erschließt, ist das eigene Auto oft der einzige Weg, um in vernünftiger Zeit von A nach B zu kommen. Es ist also weniger eine Frage der persönlichen Präferenz als vielmehr eine praktische Notwendigkeit, die den höheren Autobesitz auf dem Land erklärt.

Effiziente Infrastruktur
Stell dir ein Dorf in einem kleinen Tal in Österreich vor. Jede Familie hat ihre eigene Zufahrt, die Post muss jedes Haus einzeln anfahren, und für Wasser, Strom und Internet braucht es lange Leitungen bis ins Tal. Das kostet Ressourcen, beim Bau genauso wie im Betrieb. Die gleichen hundert Menschen in einem Stadtviertel teilen sich dagegen Gehwege, Straßenlaternen, Leitungen und die Anfahrt der Müllabfuhr. Alles ist konzentrierter, kürzer und damit deutlich effizienter. Eine groß angelegte Studie der WU Wien in Zusammenarbeit mit dem Mercator Research Institute (MCC) zeigt:
Kompakt gebaute Städte sparen durch ihre effiziente öffentliche Infrastruktur viele Emissionen. Die bebaute Fläche pro Kopf gehört zu den wichtigsten Kennzahlen zur Vorhersage von Emissionen.

Freizeit als Emissionsquelle
Tendenziell nutzen Stadtmenschen zwar weniger Autos und wohnen auf kleinerer Fläche, aber sie nutzen Freizeitangebote stark: Kino, Theater, Schwimmbad, Fitnessstudios. Das vergrößert den Fußabdruck von Städter:innen. Eine finnische Studie des Stadtplaners Jukka Heinonen hat errechnet, wie viel Energie diese Orte verbrauchen und so den ökologischen Vorteil der Stadt zum Teil aushebeln. Kinos oder Schwimmbäder müssen beheizt, beleuchtet und gewartet werden. Und zwar unabhängig davon, ob sie voll oder nur halb besucht sind. Heinonen bezeichnet das als den „Parallelkonsum“ der Stadt. Hinzu kommt, dass kleine Wohnflächen in Städten dazu führen, dass viele Dienste außerhalb der Wohnung genutzt werden, was Energie- und Emissionskosten mit sich bringt. Wer zum Beispiel nur eine kleine Küche hat, kocht seltener selbst, sondern geht essen oder lässt sich etwas liefern.
Wohlstand ist größerer Faktor
Zusammengefasst zeigt sich, dass das Stadtleben zwar aufgrund kleinerer Wohnungen, effizienterer Infrastruktur und gut ausgebauter Öffis tendenziell klimafreundlicher ist als das Leben auf dem Land. Doch die Realität ist komplexer.
Denn mehr noch als Stadt/Land entscheidet arm/reich. Wie viel Geld jemand hat, hat einen riesigen Einfluss auf den individuellen CO₂-Fußabdruck. Menschen mit hohem Haushaltseinkommen wohnen tendenziell auf größeren Flächen, unabhängig davon, ob sie in der Stadt oder auf dem Land leben.
Eine Studie aus dem Jahr 2023 zeigt, dass das reichste Einkommenszehntel in Österreich etwa 12 Mal so viel CO₂ ausstößt wie das ärmste Zehntel.
Wohlhabende Städter:innen besitzen oft trotz gut ausgebauter Öffis ein eigenes Auto. Nicht selten mehrere und welche mit hoher Leistung. Der Lebensstil, der mit höherem Einkommen einhergeht, wie häufiges Fliegen, der Konsum von Luxusgütern oder der Betrieb von Zweitwohnsitzen, treibt die Emissionen zusätzlich in die Höhe. Damit wird deutlich: Der Treiber von Emissionen ist unser Konsumverhalten. Und das hängt zwar auch mit unserem Wohnort, aber noch deutlich mehr mit unserem Einkommen zusammen.
Um das Klima zu schützen, müssen wir sowohl den urbanen als auch den ländlichen Raum nachhaltiger machen und gleichzeitig den Fokus auf gerechten Wohlstand und reduzierten Konsum legen. Denn egal, ob Stadt, Land oder Speckgürtel: Ein Leben im Einklang mit Klima und Umwelt ist für uns alle möglich.