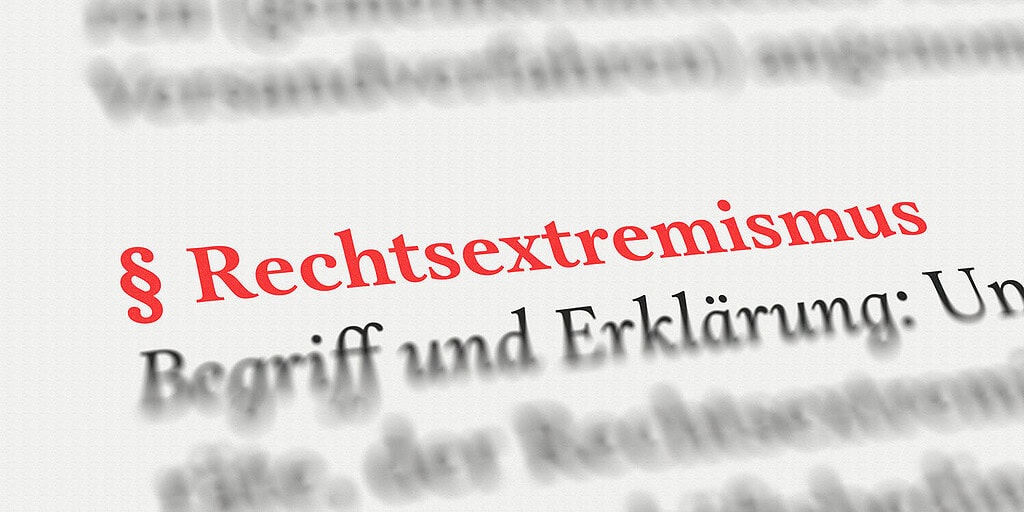Wir sind, was wir erinnern
Freda Meissner-Blau, war die erste Klubobfrau der Grünen im Parlament, Vorreiterin der österreichischen Umweltbewegung und seit 2020 Namensgeberin der Grünen Zukunftsakademie.
Anlässlich ihres zehnten Todestags erleben wir Freda noch einmal in einem bisher unveröffentlichten Gespräch vom Dezember 2014, ein Jahr vor ihrem Tod. Das ungekürzte Gespräch zwischen Journalist Michael Kerbler und Freda Meissner-Blau gibt es gleich hier zu sehen oder direkt bei YouTube.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenReisend politisiert
Geboren 1927 im deutschen Dresden, verbrachte Freda ihre ersten Lebensjahre in Reichenberg (Nordböhmen) und Linz. Nach einem Jahr in Wien emigrierte die Familie 1939 nach England, da der Vater journalistisch gegen das NS-Regime geschrieben hatte. Nach der Scheidung der Eltern kehrte sie mit ihrer Mutter zurück und studierte später in Wien Publizistik und Journalistik, wechselte aber recht bald auf Medizin in Frankfurt am Main. Dort lernte sie ihren ersten Mann Georges de Pawloff kennen. Mit ihm lebte sie mehrere Jahre im damaligen Belgisch-Kongo, wo die Erfahrungen mit Unabhängigkeitskämpfen und brutaler Kolonialherrschaft ihr späteres Engagement für eine gerechtere Welt prägten.
Von Antiatomkraft bis Umweltbewegung
In Europa arbeitete sie u.a. bei der UNESCO in Paris, setzte sich durch ihre Übersetzungstätigkeit von Atomkraftangeboten kritisch mit der zivilen Nutzung von Kernenergie auseinander. Die Antwort auf ihre Frage, was mit den hochgiftigen Brennstäben später passiere, habe sie auf der Stelle zu einer Atomkraftwerksgegnerin gemacht: „Wir zerschneiden sie, umhüllen sie mit Glas, darüber einen Stahlmantel, darüber Beton, und dann schmeißen wir sie in den Ozean“.
Freda Meissner-Blau (11. März 1927 – 22. Dezember 2015)
• Aktivistin der österreichischen Umwelt- und Anti-Atomkraftbewegung
• Führende Figur im Widerstand gegen das AKW Zwentendorf
• Mitinitiatorin der österreichischen grünen Bewegung
• Mitbegründerin der Grünen Alternative
• Erste Klubobfrau der Grünen im Nationalrat
• Namensgeberin der Grünen Zukunftsakademie FREDA
1972 kehrte Freda mit ihrem zweiten Ehemann, Paul Blau, nach Wien zurück. Mit dem wachsenden Umweltbewusstsein engagierte sie sich zunehmend im Kampf gegen Atomenergie und wurde so zu einer führenden Stimme der österreichischen Umweltbewegung. 1978 trug Freda maßgeblich dazu bei, dass in einer Volksabstimmung die Inbetriebnahme des bereits gebauten Atomkraftwerks Zwentendorf verhindert wurde. Damit wurden auch die Pläne für den Bau weiterer Atomanlage in Österreich fallen gelassen. Im Dezember 1984 spielte sie zudem eine zentrale Rolle im Widerstand gegen das Wasserkraftwerk in der Hainburger Au, die seit 1996 Teil des Nationalparks Donau-Auen ist. Die Besetzung gilt in vielen politischen Analysen als Geburtsstunde der Grünen in Österreich.
Plötzlich Politikerin
Bewusst angestrebt habe sie ihre politische Karriere nicht, erklärte Freda dem Standard 2014. Es sei alles einfach passiert, Schritt für Schritt: 1986 trat sie bereits als Grüne und erste Frau bei der Bundespräsidentschaftswahl gegen Kurt Waldheim (ÖVP), Kurt Steyrer (SPÖ) und Otto Scrinzi (FPÖ) an, den sie als „wirklich Rechtsextremen“ einstufte. Bei den Nationalratswahlen im darauffolgenden Herbst schaffte sie als Spitzenkandidatin der “ Grüne Alternative – Liste Freda Meissner-Blau“ den Einzug ins Parlament. Sie wurde Klubchefin der Grünen und damit erste Klubobfrau in der Geschichte Österreichs.

1988 legte sie nach innerparteilichen Konflikten unter anderem wegen ihres strengen Führungsstils und einer Serie von Wahlniederlagen auf Länderebene ihr Mandat nieder. Freda Meissner-Blau war leidenschaftlich und kompromisslos, was ihre Haltung zu Umweltschutz, Gleichberechtigung und Menschenrechte betraf. Und genau das machte sie polarisierend. Sie kritisierte offen politische Eliten, sprach unbequeme Wahrheiten aus und nahm „ihre“ Grünen keineswegs aus.
Gegner:innen bezeichneten sie als moralisch überhöht und kritisierten ihren Mangel an politischem Pragmatismus. Ihre Unterstützer:innen nannten sie wiederum das „Gewissen der Republik“. Beides spiegelt auf unterschiedliche Weise Facetten ihrer Persönlichkeit – und erklärt, warum sie in Erinnerung bleibt.