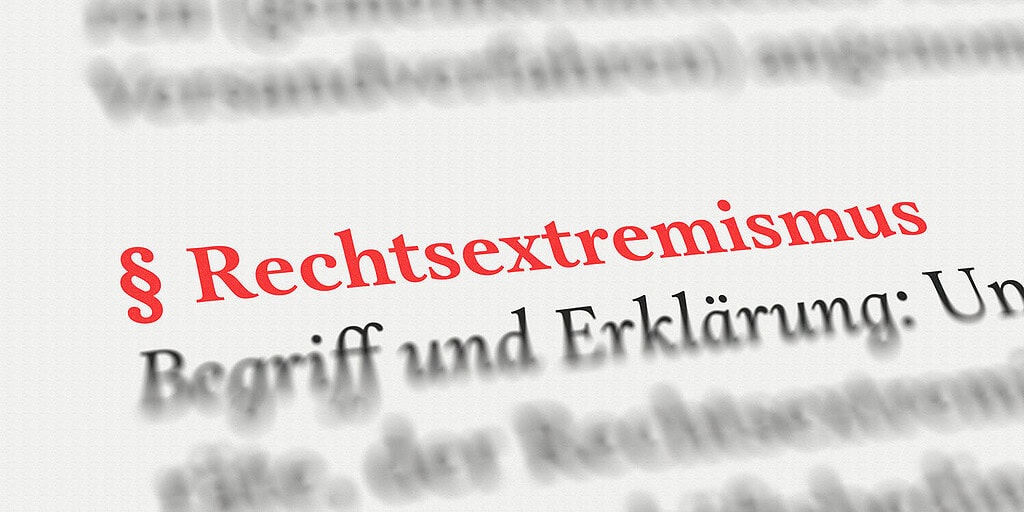Wir leben in einer Elektroschrott-Era
Wir sind tagtäglich umgeben von Technik: im Wohnzimmer, in der Küche und in unseren Hosentaschen. Noch nie war Technologie so innovativ und gleichzeitig so kurzlebig. Und genau das wird zunehmend zum Problem.
Jedes Jahr werfen wir Millionen funktionierender Geräte weg und ersetzen sie mit dem neuesten Upgrade. Allein 2022 fielen weltweit 62 Millionen Tonnen Elektroschrott an. Nur rund 22 Prozent davon werden ordnungsgemäß wiederverwertet. Unser Elektromüll entwickelt sich rasend schnell zu einem globalen Umweltproblem.
Zeitalter der Wegwerfkultur
Jedes Jahr gibt es aufs Neue ein Wettrennen um das beste neue Gerät auf dem Markt. Eine bessere Kamera hier, ein schnellerer Prozessor da – und schon scheint unser eigenes Gerät „veraltet“ zu sein. „Fast Tech“ nennen Expert:innen das System aus Überproduktion und Überkonsum. Es basiert auf Geräten, die absichtlich so gebaut werden, dass sie schon bald wieder ersetzt werden müssen. Hersteller:innen verbauen verklebte Akkus, verweigern Software-Updates oder erschweren Reparaturen. So werden Geräte künstlich auf kurze Lebenszyklen getrimmt. Es entsteht ein endloser Kreislauf aus Neuanschaffungen und Updates.
Laut dem Global E-Waste Monitor 2024 der Vereinten Nationen gilt der Elektroschrott heute als die am schnellsten wachsende Abfallkategorie der Welt. Bis 2030 könnten es bereits 82 Millionen Tonnen jährlich werden. Allein in Österreich fallen laut Global 2000 jährlich 83.000 Tonnen Elektroschrott an.
Ökologischer Preis der Digitalisierung
Die Klimabilanz unserer Geräte fällt ernüchternd aus. Rund 40 Prozent der Emissionen digitaler Technologien entstehen bereits in der Herstellung, also lange bevor das Gerät überhaupt eingeschaltet wird.
Elektrogeräte enthalten wertvolle Metalle, wie Gold, Kupfer oder Aluminium. Die Produktion verschlingt aber auch seltene Erden wie Kobalt, Tantal und Zinn. Rohstoffe, die oft unter widrigen Arbeitsbedingungen abgebaut werden und unserer Umwelt und Gesundheit schaden. Unser weltweiter Technikkonsum trägt rund vier Prozent zu den weltweiten Treibhausgasemissionen bei und könnte 2040 schon bei 14 Prozent liegen.
„Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass all die Geräte, die sie ständig benutzen und austauschen, zu Überkonsum, massiver Umweltverschmutzung und Klimawandel beitragen.“
Die Kunst des Wegwerfens
Wie problematisch unsere Fixierung auf das „nächste große Ding“ ist, zeigte eine Kampagne des Refurbished-Anbieters, Back Market, 2025. Mit Vorher-/Nachher-Bildern, dargestellt durch verschiedene iPhone-Modelle, machten sie sichtbar, wie stark bestimmte Orte der Welt durch unsere ständigen Upgrades beeinflusst werden. Der Appell: Technologie muss länger leben. Wir müssen reparieren und wiederverwenden, statt wegzuwerfen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenReparieren statt Wegwerfen
Auch in Österreich hat man sich diesem Thema angenommen. Einen kleinen Hoffnungsschimmer bot der Reparaturbonus, der 2022 startete. Er sollte Bürger:innen finanziell bei der Reparatur ihrer Gegenstände unterstützen. Das Programm war ein voller Erfolg: Über 1,7 Millionen Reparaturbons wurden eingelöst.
Doch im Mai 2025 kam das abrupte Aus wegen angeblich „ausgeschöpfter Mittel“. Eine Recherche von Moment ergab aber, dass rund 80 Millionen Euro noch verfügbar gewesen wären.
Im Dezember soll die Förderung nun unter neuem Namen zurückkehren. Die „Geräte-Retter-Prämie“ soll den Menschen wieder die Möglichkeit geben, ihre Dinge günstiger zu reparieren. Allerdings dieses Mal ohne Smartphones und Fahrräder – also genau jenen Geräten, die zuvor am häufigsten mit dem Reparaturbonus repariert wurden. Umweltsprecher Lukas Hammer von den Grünen kritisiert die Einschränkungen: „Eine weitere schmerzhafte Kürzung von Umweltminister Totschnig im Bereich Umwelt- und Klimaschutz.“
Auch auf EU-Ebene wächst der Druck: Seit Juli 2024 gilt eine Richtlinie für das Recht auf Reparatur. Um übermäßigen Konsum zu bekämpfen und die Klimaziele zu erreichen, werden Reparaturen für mehr Produktgruppen verpflichtend, Garantiezeiten verlängert und Drittanbieter-Ersatzteile ermöglicht. So soll endlich Schluss sein mit der geplanten Obsoleszenz.
Geplante Obsoleszenz bedeutet, dass Hersteller Produkte absichtlich so gestalten, dass sie nach einer bestimmten Zeit unbrauchbar werden oder veralten – obwohl sie technisch länger halten könnten.
Was wir alle tun können
Auch wenn es Politik und Industrie möglich wäre, die größten Hebel zu umlegen, können auch wir Konsument:innen etwas beitragen:
- Geräte länger nutzen: Wir müssen nicht jedes neue Gerät kaufen. Wichtig ist es, sich vor dem Kauf Gedanken zu machen, welches Gerät für einen selbst das Passende ist. Ein Gerät, mit dem man zufrieden ist, behält man auch länger.
- Reparieren statt Wegwerfen: Halte dein Gerät sauber und entferne regelmäßig Staub aus den Ladebuchsen. Das verbessert die Leistung und die Lebensdauer. Repariere und ersetze Teile, um dein Gerät möglichst lange zu nutzen.
- Kaufe gebraucht statt neu: Refurbished-Technik verursacht bis zu 92 % weniger Co2-Emissionen als neue Produkte. Bevor du dir also ein neues Gerät suchst, durchforste das Refurbished-Angebot nach passender Technik für dich.
- Werde dir bewusst über die Ressourcen: Dein Handy enthält wertvolle Materialien, die recycelt werden sollten, statt im Müll zu landen.
- Weitergeben statt vergessen: Wir alle haben ungenutzte Technik zu Hause. Bevor die Geräte zu alt werden, gib sie weiter an Freund:innen oder die Verwandtschaft. So erhält dein Gerät ein neues Leben.
Fast Tech ist kein Naturgesetz, an dem nicht gerüttelt werden kann. Wir sollten alle unser Verhältnis zur Technologie überdenken und Langlebigkeit statt Wegwerf-Mentalität wählen. Denn die beste Technik ist nicht die neueste, sondern die, die bleibt.